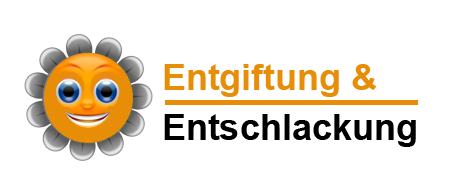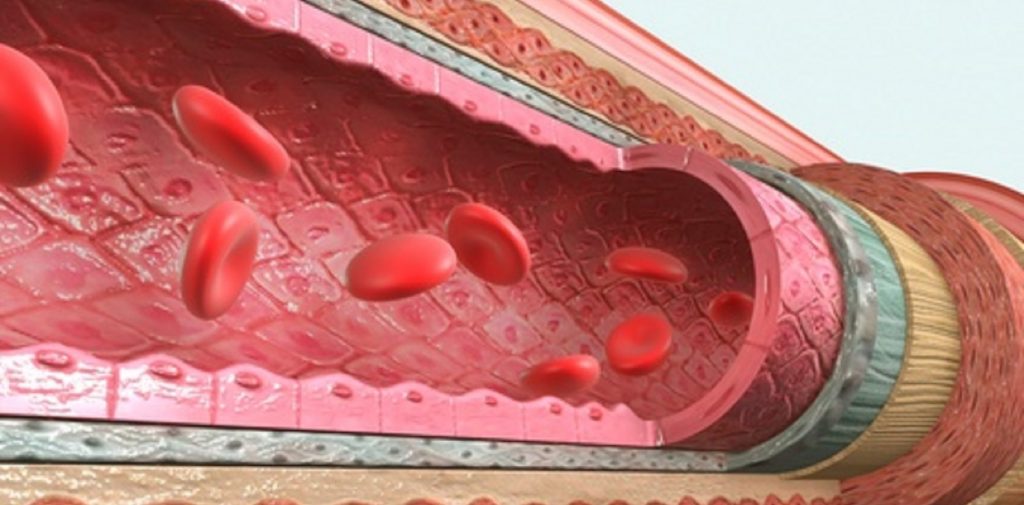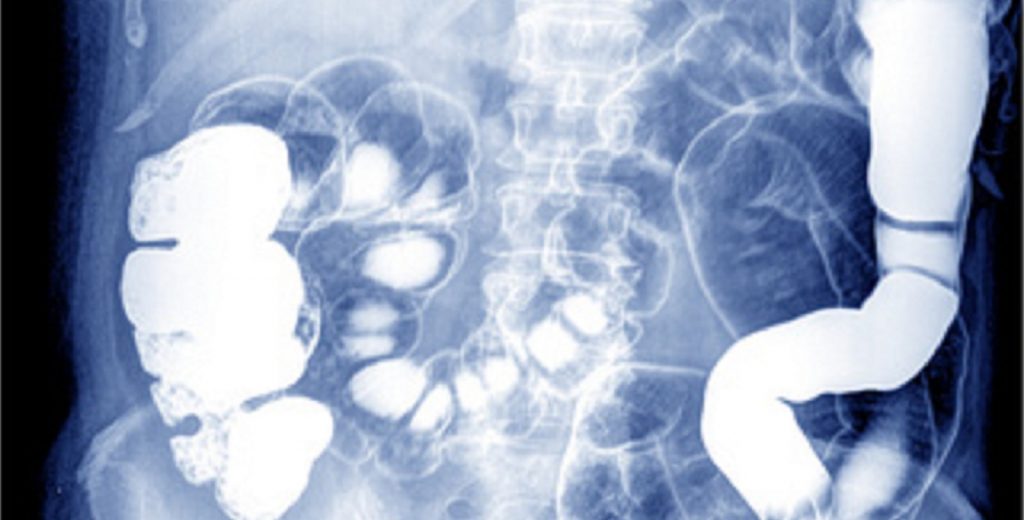Es gibt schlechte Neuigkeiten in Bezug auf Glyphosat. Zuvor aber noch mal ein Rückblick auf die Beiträge, die die „alten Neuigkeiten“ diskutieren:
- Glyphosat-Gift im Bier
- Glyphosat – sicher unsicher?
- Glyphosat – Gifte und Gentechnik außer Kontrolle
- Glyphosat im Brötchen – Unser tägliches Gift gib uns heute
- Glyphosat in Nahrungsmitteln: Warum dieses Gift verboten werden muss!
Auch hier gibt es anscheinend wieder einmal eine Kluft zwischen wissenschaftlichen Fakten und politischen Interessen, die sich mit den Interessen der Industrie decken:
Das politische und industrielle Interesse ist so groß, dass sogar umweltschützende Grüne ihre Ideale über Bord werfen und sich dem „schnöden Mammon“ andienen:
Kein Wunder also, dass gerade die Grünen in beeindruckender Weise bei den Corona-Gen-Injektionen ihre alten Ideen in Bezug auf die Manipulation von Organismen haben fahren lassen und für die Pflicht-Genmanipulation der Bevölkerung gestimmt haben. Aber das nur am Rande.
Seit 1974 sind weltweit 8,6 Milliarden Kilogramm Glyphosat in der Umwelt verteilt worden. Davon sind zwei Drittel im letzten Jahrzehnt eingesetzt worden.
Glyphosat ist der Hauptbestandteil in Herbiziden wie Roundup, welches früher vom Hersteller Monsanto als „biologisch abbaubar“ und „umweltfreundlich“ beworben wurde. Monsanto ging sogar so weit, zu behaupten, dass die Substanz „den Boden säubere“. Im Jahr 2009 erschien ein Beitrag der BBC, der berichtete, dass Frankreichs höchstes Gericht Monsanto diesbezüglich der Lüge überführt hat.[1]
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Glyphosat und das Darmmilieu
Neben den schädlichen Wirkungen von Glyphosat auf den menschlichen Organismus, die ich in meinen Beiträgen (siehe oben) diskutiert hatte, gesellt sich jetzt eine weitere schädigende Wirkung, die möglicherweise die krebserzeugende Wirkung von Glyphosat und andere Schäden zu erklären vermag.
Im Mai 2023 erschien eine Arbeit aus den USA, die zeigen konnte, dass Glyphosat in geringen Dosierungen bereits das Darmmilieu, genauer gesagt die Zusammensetzung der Darmflora, so verändert, dass die Homöostase im Darm gestört wird.[2]
Die Forscher der Universität von Iowa gaben Mäusen Glyphosat in Konzentrationen, die von den offiziellen Behörden der USA als „akzeptabel“ eingestuft werden, das heißt 1,75 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Danach wurde der Stuhl der Tiere analysiert und die Zusammensetzung der Bakterienkulturen bestimmt. Diese Zusammensetzung zeigte sich dann als signifikant verändert, was sich auch in physiologischen Konsequenzen bemerkbar machte: Entzündungsfördernde T-Zellen und Lipocalin-2, ein Marker für Entzündungen im Verdauungstrakt, waren unter diesen geringen Konzentrationen bereits signifikant erhöht.
Wie erklärt man sich die Veränderung der Zusammensetzung?
Glyphosat tötet Unkräuter ab, indem es das Enzym 5-Enolpyruvylshikimat-3-Phosphat-Synthase (EPSPS) hemmt, das ein zentraler enzymatischer Schritt des Shikimat-Weges ist, der für die Biosynthese aromatischer Aminosäuren (Phenylalanin, Tyrosin und Tryptophan) verantwortlich ist. Der Shikimat-Stoffwechselweg kommt hauptsächlich in Pflanzen und einigen Mikroorganismen vor, wo viele „Off-Target-Effekte“ von Glyphosat berichtet wurden.
Da Säugetiere nicht über den Shikimat-Stoffwechselweg verfügen, wurde zunächst angenommen, dass Glyphosat keine negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben könnte. Mehrere Studien haben jedoch einen Zusammenhang zwischen Glyphosat-Exposition und verschiedenen Krankheiten, einschließlich Krebs, hergestellt. Diese Ergebnisse haben dazu geführt, dass das Verständnis der potenziellen Mechanismen, durch die eine Glyphosat-Exposition toxische Wirkungen beim Menschen hervorrufen kann, immer wichtiger wird.
In diesem Zusammenhang hat sich die Darmmikrobiota als möglicher Zusammenhang zwischen Glyphosat und den beim Menschen festgestellten gesundheitlichen Beeinträchtigungen herausgestellt. Billionen von Bakterien (Darmmikrobiota), die im menschlichen Darm leben, spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des gesunden Zustands des Menschen durch die Regulierung verschiedener physiologischer Prozesse des Wirts, einschließlich der Entwicklung und Aufrechterhaltung des Immun-, Hormon- und Nervensystems.
Da Bakterien den Shikimat-Stoffwechselweg nutzen, könnte Glyphosat die Zusammensetzung der Darmmikrobiota verändern, indem es Darmbakterien hemmt, die glyphosatempfindliche EPSPS-Enzyme beherbergen.
Oder mit anderen Worten: Wer behauptet, dass Glyphosat für den Menschen unschädlich sein muss, weil hier ein Enzymsystem blockiert wird, was im menschlichen Organismus nicht vorkommt, der blendet die Bedeutung des Darmmilieus für die Gesundheit aus. Denn im Darm sitzen Bakterien, die offensichtlich empfindlich auf Glyphosat reagieren, wie zum Beispiel Lactobacillus und Bifidobacterium.
Auf der anderen Seite gibt es pathogene Bakterien, zum Beispiel Clostridium perfringens und Salmonella typhimurium, die nahezu unempfindlich auf Glyphosat reagieren, was zu einer Verschiebung der Balance zwischen nützlichen und schädlichen Bakterien im Darm zugunsten der Schädlichen führt.
Da rund 80 Prozent der immunkompetenten Zellen des Organismus im Darm sitzen, dürfte dies auch für das Immunsystem von Bedeutung sein, allerdings im negativen Sinne. Über die Schwächung des Immunsystems durch diese Prozesse lässt sich auch das erhöhte Krebsrisiko durch Glyphosat-Exposition erklären, da das Immunsystem einen Hauptfaktor bei der Abwehr gegen maligne Zellen darstellt.
Fazit
Es ist seit längerem bekannt, dass Glyphosat die bakterielle Zusammensetzung im Darm in hohen Dosierungen verändert. Für die Glyphosat-Freunde ist dies das Argument, nicht auf Glyphosat zu verzichten, da geringe Konzentrationen angeblich „unschädlich“ seien. Diese Arbeit jedoch hat jetzt gezeigt, dass auch die in den Grenzwerten liegenden Konzentrationen von Glyphosat die Zusammensetzung der Darmflora so weit verändern, dass Entzündungsfaktoren aktiviert werden und damit krankheitsfördernde Prozesse im Darm begünstigt werden.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Quellen:
[1] BBC NEWS | Europe | Monsanto guilty in ‚false ad‘ row
[2] Low-dose glyphosate exposure alters gut microbiota composition and modulates gut homeostasis – ScienceDirect
Beitragsbild: fotolia.com – adiruch_na_chiangmai